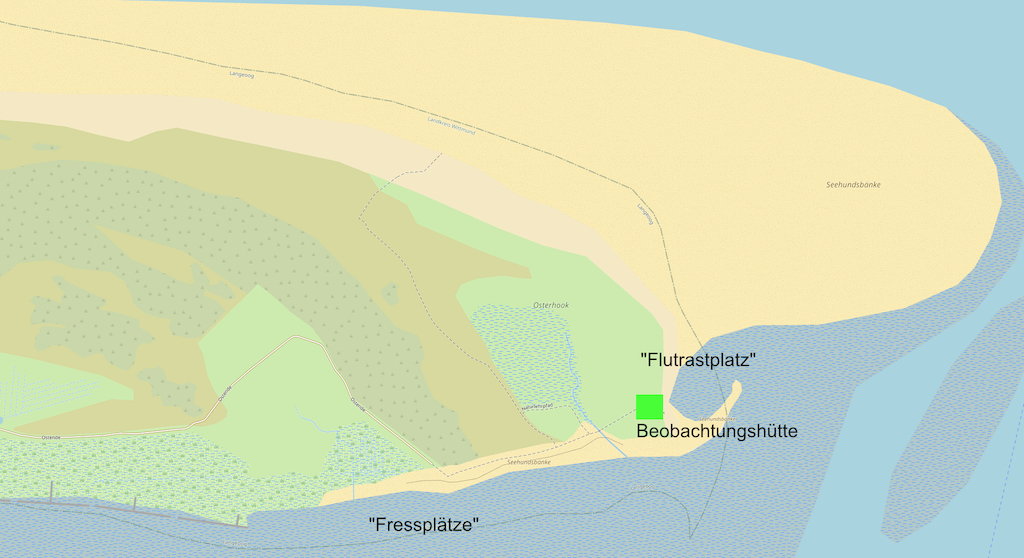Seit Februar können wir sie wieder sehen, die Akrobaten der Lüfte mit ihrem kontrastreichen Gefieder. Eine metallisch glänzender schwarzer Oberseite und eine weiße Unterseite hat nur er. Ebenso kennzeichnend sind das schwarze Brustband sowie die abstehende „Federholle“ am Hinterkopf. Während seiner Flüge ruft er laut seinen Namen „Ki-witt“ – der Kiebitz.

Bild 1 Kiebitz in seiner natürlichen Umgebung (aufgenommen bei Schalbruch)

Bild 2 Kiebitz im Flug
Der Kiebitz ist stark gefährdet
„In Deutschland wurden zuletzt nur noch rund 42.000 bis 67.000 Brutpaare gezählt. Die massiven Einbrüche seiner Population sind schon seit Längerem ein besorgniserregender Trend: Allein zwischen 1980 und 2016 ist seine Zahl um 93 Prozent zurückgegangen.
Auch europaweit hat sich die Population mehr als halbiert. Inzwischen gilt der Kiebitz auf dem europäischen Kontinent als gefährdet und deutschlandweit sogar als stark gefährdet.“ /1/
„Die Ursachen für die dramatischen Bestandsrückgänge sind vielfältig. Dazu gehören der anhaltende Flächenverbrauch, die Zerschneidung von Lebensräumen oder Störungen durch menschliche Freizeitaktivitäten. Als hauptverantwortlich gilt jedoch die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und der damit verbundene Lebensraumverlust. Viele Wiesen und Weiden werden trocken gelegt, stark gedüngt, immer früher und häufiger bearbeitet oder zu Äckern umgebrochen. Wo früher Sommergetreide angebaut wurde, steht heute vielerorts Wintergetreide. /2/
In Ermangelung des ursprünglichen Lebensraumes ist der Kiebitz vielerorts auf unsere Felder „umgezogen“. Hier ist er neuen Gefahren ausgesetzt, doch es lässt sich etwas für den Kiebitz tun.
Kiebitzschutz im Selfkant
Wo Kiebitze brüten, kann es zweckmäßig sein, das Gelege mit einer Markierung zu kennzeichnen. Seit nunmehr 10 Jahren markiert Peter Hamacher die Kiebitzbrutplätze auf dem Gebiet der Gemeinde Selfkant mit Stäben, so dass die gut getarnten Gelege für den Landwirt zu sehen sind. Da erwachsene Kiebitze in der Regel auch gut zu beobachten sind, kann deren Anzahl auf Einzelflächen leicht ermittelt werden. Die Betreuung der Kiebitze endet erst, wenn die Jungvögel flügge sind. Darüber hinaus wird das Kiebitzaufkommen kartiert und verschiedenen Naturschutzbehörden bzw. – einrichtungen (UNB/Untere Naturschutzbehörde des Kreis Heinsberg, LANUV/Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Michael-Otto-Institut im NABU) gemeldet.

Bild 3 Peter Hamacher bei der Markierung eines Nestes

Bild 4 Kiebitzgelege
Peter Hamacher steht darüber hinaus in Kontakt mit den Landwirten und versucht geeignete Schutzmaßnahmen mit diesen abzusprechen. Als beispielhaft ist die Zusammenarbeit mit den Landwirten Josef Hensgens aus Havert, Fam. Meuwissen aus Stein und Fam. Janßen aus Großwehrhagen zu nennen, die in jedem Jahr bei ihren Feldarbeiten auf die Kiebitze Rücksicht nehmen. Die gekennzeichneten Gelege werden bei der Bodenbearbeitung im Frühjahr durch Umfahren geschützt. Leider sind nicht alle Landwirte dem Kiebitz gegenüber so aufgeschlossen.

Bild 5 Rivalisierende Männchen

Bild 6 Männchen nach der Auseinandersetzung

Bild 7 Paarung

Bild 8 Nachwuchs (aufgenommen in Langeoog 2023)
Bei Großwehrhagen gibt es ein weiteres schönes Beispiel für den Kiebitzschutz. Hier hat Nicolai Dreißen eine Kiebitzinsel auf seinem Acker eingerichtet. „Kiebitzinseln (‚lapwing plots‘) wurden in Großbritannien zum Schutz des Kiebitzes beziehungsweise des Triels (Burhinus oedicnemus) entwickelt (Sheldon et al. 2007; Chamberlain et al. 2009; MacDonald et al. 2012). Sie sollen Brut- und Nahrungsflächen für Kiebitze und andere Feldvögel darstellen.“ /3/

Bild 9 Ein Kiebitz vertreibt eine Krähe

Bild 10 Kiebitzschwarm auf dem Weg in den Norden Deutschlands
Der Kiebitz benötigt zur erfolgreichen Nahrungssuche und Brut Flächen mit offenen Bodenstellen und einer niedrigen Vegetation. Nur dort kann er seine Feinde schnell entdecken, Jung- und Altvögel finden hier ausreichend Nahrung.
Diese Voraussetzung ist auf dieser Kiebitzinsel gegeben. Durch das Liegenlassen eines abgeernteten Feldes oder nach einer nur ganz groben Bearbeitung im Herbst bleibt eine geeignete Brutfläche für den Kiebitz auch im Frühjahr bestehen.
Begonnen hat die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Dreißen in Sachen Kiebitzschutz vor 2 Jahren, als er auf seinem Feld erstmals der Einrichtung einer Kiebitzschutzinsel zustimmte. Der gute Bruterfolg führte im vergangenen Jahr dazu, dass dort sogar mindestens 5 Paare erfolgreich brüten konnten. Entscheidend für diesen großartigen Erfolg war die Vereinbarung, mit der Feldbearbeitung und anschließender Maisaussaat bis Anfang Mai zu warten, da in der Regel das eigentliche Brutgeschäft dann beendet ist.
Dass in diesem Jahr dorthin erneut mehr Kiebitze zum Brüten zurückgekehrt sind, zeigt, wie künftig ohne großen Aufwand erfolgreich Kiebitzschutz auch in der Agrarlandschaft möglich ist.
Herr Dreißen hat sich auch in diesem Jahr bereit erklärt, mit der Bearbeitung seines Feldes bis Anfang Mai zu warten, nicht zuletzt auch deswegen, weil erneut mehrere Paare sein Maisstoppelfeld als Bruthabitat ausgewählt haben.
Herr Dreißen leistet mit seiner großzügigen Zusammenarbeit beim Kiebitzschutz Pionierarbeit und zeigt einen Weg auf, wie zukünftig im Selfkant durch rechtzeitige Absprachen erfolgreich den stark gefährdeten Kiebitzen geholfen werden kann.
Was kann Jederman für den Kiebitz tun?
Freilaufende Hunde sind für junge Hasen und Rehe eine Gefahr. Wenn ein Hund plötzlich zum Jagen losspurtet, kann das auch für den Kiebitznachwuchs tödlich enden.
„Wenn Altvögel ein Nest verlassen, ist das Gelege gefährdet. Bei bedecktem Himmel reicht schon eine Viertelstunde, dass die Embryonen im ausgekühlten Ei absterben. Altvögel kehren zwar normalerweise wieder zum Gelege zurück, aber nicht, wenn eine Störung auf die andere folgt. An schönen Wochenenden, wenn Hunderte Menschen und Hunde unterwegs sind, geben Wildvögel oft ihre Gelege ganz auf.“ /4/
Also bitte den Hund an der Leine nehmen und Abstand zu den markierten Flächen halten.
Artenschutz hat zum Ziel, die Vielfalt der Natur zu bewahren. Eine möglichst große Vielfalt in einem Ökosystem ist wichtig für seine Stabilität. Und auch unsere Kinder möchten sich später an solchen Bildern erfreuen und nicht nur vom Hörensagen von Oma und Opa kennen.
Kiebitze beobachten
„Insbesondere die Männchen der Kiebitze verteidigen ihre Reviere und vollführen im Frühjahr beeindruckende Balzflüge. Dennoch werden geeignete Flächen häufig von mehreren Paaren in lockeren Kolonien besiedelt.“ /3/ Nähern sich Krähen oder Greifvögel dem Kiebitzrevier, starten die Männchen gemeinsam Abwehraktionen. Selbst Graureiher werden mit Erfolg attackiert und vertrieben. Nahrungssuchende Kiebitze deuten meist nicht auf einen Brutplatz in der Nähe hin.
Vor dem Auffliegen laufen Brutvögel zunächst von ihrem Nest weg. Bei der Rückkehr landen sie in etwas Entfernung vom Gelege und laufen dann zielstrebig zum Nest.
Küken führende Kiebitze sind sehr aufmerksam und stehen aufrecht, die Umgebung beobachtend. Im Flug warnen sie mit hängenden Beinen.

Bild 11 Balz

Bild 12 im Flug
Kiebitze lassen sich am besten vom Feldweg aus per Fernglas beobachten. So werden sie nicht gestört. Fangen die Kiebitze an zu warnen oder fliegen sogar davon, sollte man sich wieder entfernen. Und für Fotografen gilt: Tierschutz geht vor Foto! Hier hat sich insbesondere die Beobachtung aus dem Auto heraus bewährt.
Lesetipp: „Praxishandbuch Kiebitzschutz.“ Das Dokument kann kostenlos als pdf bezogen werden und bietet viel Wissenswertes über den Kiebitz /5/
/1/ https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/2024/index.html
/2/ https://lapwingconservation.org/kiebitz/rueckgang/
/3/ Der Sympathieträger Kiebitz als Botschafter der Agrarlandschaft
Umsetzung eines Artenschutzprojektes zur Förderung des
Kiebitzes in der Agrarlandschaft
Bundesprogramm Biologische Vielfalt
Förderschwerpunkt Arten in besonderer Verantwortung
Deutschlands
FKZ: 3514 685A01/B01/C01
/4/ https://www.br.de/nachrichten/bayern/freilaufende-hunde-gefahr-fuer-rehkitz-kiebitz-und-co,T6SSHHA
/5/ https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/kiebitz/19483.html
Revierkämpfe